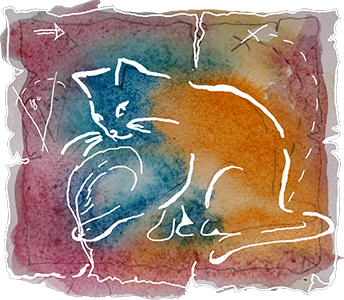Die Welt steht am Abgrund und es muss Farbe bekannt werden! Darf man hunderte von Menschen opfern um Tausende zu retten? Darf man das Grundgesetz brechen um Extremisten zu bekämpfen? In Terror steht ein Mann deswegen vor Gericht und die Entscheidung über sein Schicksal treffen Sie! Ja, SIE! Sie und alle anderen Fernseh- oder Kinozuschauer, die einen Zettel ausfüllen, eine Hotline anrufen, die Internetseite der ARD erreichen oder sich generell einen feuchten Kehricht darum scheren, bei dieser meta-medialen Farce mitzumachen.
Wenn die Abende spät und die Biere leerer werden, sitzt man ja manchmal zusammen und fragt sich Dinge wie: „Wenn du in einem Raumschiff sitzt, das abstürzt, und nur ein trainierter Schimpanse oder Adolf Hitler könnten es landen…wem würdest du dann das Steuer übergeben?“ Dann faselt man etwas Zeug und lacht herzlich über die Absurdität der Situation und darüber, dass man doch irgendwie noch Nietzsche zitieren konnte, um sein Argument zu stärken, weil man mal einen Philosophiekurs in der Abendschule besucht hat.
Doch als der Charakterdarsteller Burghart Klaußner mir plötzlich mit steinerner Miene in die Augen blickt und klar macht, dass hier ein Menschenleben auf dem Spiel steht und ich darüber entscheiden muss, fällt mir fast mein Müslilöffel aus dem Mund. Eins ist klar: Ich habe eine große Verantwortung zu tragen während der nächsten 90 Minuten. Besser, ich mach‘ mir Notizen.
In der Theateradaption des Ferdinand von Schirach Stücks Terror geht es um ein fiktives Szenario, dass sich auffällig nach 9/11 anhört. Ein Flugzeug wurde entführt, Ziel des Terroristen ist vermeintlich das prall gefüllte Olympiastadium. Ein junger Soldat (Florian David Fitz) schießt entgegen direkter Befehle das Flugzeug ab, tötet dabei 164 Menschen, rettet aber vielleicht 70.000. Wir erleben den Gerichtsprozess gegen ihn aus nächster Nähe mit. Und nach und nach dreht sich sowohl dem Filmliebhaber, dem Medienkritiker als auch dem Hobbyphilosophen in mir der Magen um.
Der Film Terror ist in gewisser Art und Weise ein Nicht-Film, ein Pamphlet. Die Figuren sind Schablonen, die dazu dienen Meinungen und Gedankengänge greifbar zu machen, die Dialoge schwanken entsprechend zwischen Moralpredigt und Infotalk. Alles wirkt sehr trist, sehr distanziert, sehr konstruiert, sehr als würde es eher auf die Bühne als auf den Bildschirm gehören oder in ein studentisches Essay über Recht und Gerechtigkeit.
Während wir Details über die deutsche Luftwaffe vorgetragen bekommen und einige Artikel über das Grundgesetz und Bundestagsentscheidungen durch den Raum wehen wie Heuballen, werden immer wieder emotionale Momente forciert, die erstaunlich fehl am Platz wirken. Wenn die Kamera an den wichtigen Stellen bedeutungsschwanger zoomt, klingt ein dramatisches DAM-DAM-DAAAAM im Kopf mit. Von der Finesse eines Sidney Lumet sind wir Lichtjahre entfernt, aber man kriegt eine gewisse Vorstellung davon, wie eine Folge Richter Alexander Hold aussähe, wenn bessere Schreiberlinge und ein Millionenbudget zur Verfügung stünden.
Fairerweise sei gesagt, dass diese trockene Darstellungsweise und die Entfernung zum Zuschauer höchstwahrscheinlich Teil des Konzeptes waren, aber es bleibt ein Konzept, das nur schwerlich aufgeht und das liegt nicht zuletzt am zugrunde liegenden Gimmick.
Im 60er Jahre Horrorschinken Mr. Sardonicus trat der Meister der Filmgimmicks, Regisseur William Castle, gegen Ende kurz vor das Publikum und bat es, über das Schicksal des Bösewichts zu entscheiden. Eine vorher verteilte Karte mit einem Daumen musste nach oben oder unten gehalten werden, während Castle auf der Leinwand zählte und stets zu dem Schluss kam, dass die Mehrheit Sardonicus tot sehen will. Dieses spielerische Prinzipium wird mit Terror jetzt Realität: Es gibt eine echte Abstimmung, die über das Schicksal der Hauptfigur entscheidet. Effektiv ändert sich aber nur eine einzige Szene, nämlich die Urteilsverkündung.
Da es allerdings nur zwei Auswahlmöglichkeiten gibt, gleicht Terror weniger einem interaktiven Erlebnis, als einem Choose-your-own-Adventure-Buch mit nur drei Seiten. Zugegeben, das Ergebnis interessiert einen als Zuschauer, aber die Verkündung ist nicht mehr als ein Infococktail und die Figuren sind einem ebenso egal, dass eine Balkengrafik den gleichen emotionalen Eindruck hinterlassen hätte. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass Castle weiß, dass er sich nicht ernst nehmen kann, während Terror keinen Zweifel daran lassen will, wie relevant, kontrovers und moralisch herausfordernd dieser Film ist.
Das ist er aber nicht.
Das Gewicht, das Terror von der ARD zugesprochen wird, macht sich erdrückend bemerkbar als nach dem Hauptfilm eine Episode Hart aber Fair gezeigt wird, in der Politiker, Geistliche und Militärabgeordnete über den Film reden, als sei er ein Teil unserer Lebensrealität. Schmerzlich vermisse ich einen Medienwissenschaftler, der diesen Menschen klarmacht, dass wir ein konstruiertes Szenario beobachtet haben und Vergleiche mit wirklichen Ereignissen leicht pietätlos sind. Über diese Figuren zu reden, als wären sie echte Menschen, über dieses Szenario, als sei es gerade passiert – das grenzt an Hohn. Die Causa Terror ist nicht der Fall Eichmann und je mehr er sich um Glaubwürdigkeit bemüht, indem er populäre Dilemmata der westlichen Philosophie erwähnt und oft laut den Namen Kant in den Mund nimmt, desto mehr verkommt er zum fleischgewordenen Bildungsbürger-Stammtisch.
Das Traurigste an diesem ganzen Mummenschanz ist, dass der Film und die um ihn entstandene Kampagne suggerieren, dass es möglich ist, für komplexe moralische Probleme einfache Ja-Nein-Antworten zu finden. Wenn man alle Fakten kennt – so die These – muss man als Mensch eine Entscheidung treffen können, die eindeutig ist. Aber selbst mir als Küchenphilosophen ist klar, dass Moralphilosophie so nicht funktioniert. Der Diskurs, der angeboten wird, ist kein echter, sondern am Ende wird man gezwungen, alles in eine Schublade zu stecken.
Eine Idee, die oft im Film angesprochen wird ist, dass man in Extremsituationen nach eigenem moralischen Empfinden urteilen muss. Aber genau das tun wir hier nicht. Es wird uns abgenommen über eine Situation zu urteilen, sondern wir urteilen über eine Figur und das ist etwas völlig anderes. Der einzige wirkliche Ausweg für den Zuschauer als aufrechtes moralisches Wesen wäre eine Enthaltung oder eine ausführliche Stellungnahme. Doch dieses Recht bleibt uns verwehrt.
Wenn Jack Nicholson in A Few Good Men vor Gericht eine widerliche Weltansicht propagiert, scheint sie dennoch erschreckend realistisch – und das macht uns nervös. Auch hier handelt es sich um ein adaptiertes Theaterstück, auch hier um ein Gerichtsszenario. Den Unterschied machen die dramatische Struktur und die spannenden Figuren, die hier um ein Thema kreisen, statt der Pappkameraden, die dem Zuschauer bei Terror eine Pistole auf die Brust setzen und zum Statement nötigen wollen.
Das trennt einen guten Film von dem Gedankenexperiment Terror: Er eröffnet eine moralische Kontroverse, über die der Zuschauer freiwillig reflektiert, anstatt dazu gezwungen zu werden. Er lässt mehrere Schlüsse zu und wirkt noch nach, anstatt gleich aus dem Kopf zu verschwinden, sobald man eine binäre Entscheidung getroffen hat. Der Zuschauer, der diese Entscheidung trifft, ohne das Konzept zu hinterfragen, macht sich einer ganz anderen Tat schuldig.
Denn man sollte sich spätestens dann um seine säuberlich konstruierte moralische Zwickmühle Sorgen machen, wenn die einzig richtige Antwort auf die Aufforderung nun endlich für schuldig oder nicht schuldig zu stimmen aus einer quirligen 80er Jahre Komödie kommt:
„The only winning move is not to play.“